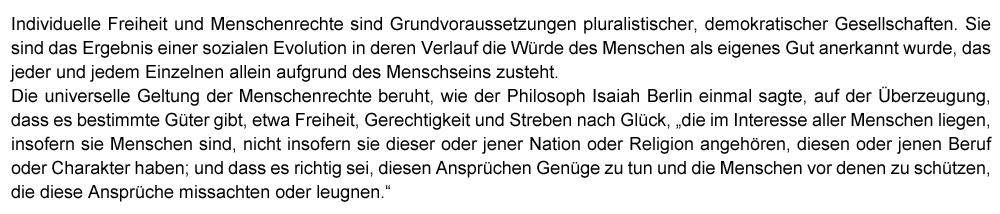Wie bereits im Artikel über die Verbotsgesellschaft dargelegt, haben sich westliche Regierungen einem neuen Paternalismus verschrieben. Sie fühlen sich ebenso für die Gesundheit wie für das gesunde Verhalten ihrer Bürger verantwortlich und Sicherheit in jeder Lebenslage mutiert zum höchsten aller Werte. Das gilt insbesondere für die Politik der inneren Sicherheit, den Kampf gegen Terrorismus und Kriminalität. Dieser scheint nur erfolgreich geführt werden zu können, wenn die Bürger in die Position zu überwachender Schutzbefohlener versetzt werden. So, wie uns im Gesundheitsbereich suggeriert wird, wir würden nicht mehr krank werden (vermutlich nicht einmal mehr sterben), wenn wir uns nur endlich gesund ernährten, Sport trieben und auf Tabak und Alkohol verzichteten, wobei uns die Regierung tatkräftig mit entsprechenden Verboten und Geboten unterstützen wird, so wird uns im Bereich der inneren Sicherheit suggeriert, alle Gefahren könnten von uns abgewendet werden, wenn der Staat, Polizei und Geheimdienste nur genügend Ermittlungs- und Überwachungsmöglichkeiten bekämen. Weiterlesen
Archiv des Autors: Heiko Heinisch
Die Goldene Regel
In öffentlichen Diskussionen, vor allem wenn es um die sogenannten interreligiösen und interkulturellen Dialoge geht, wird immer wieder die Goldene Regel bemüht, die, so der Tenor, als ethische Grundlage aller Religionen und Kulturen diene – das Weltethos in einen Satz gegossen. Selten wird erwähnt, dass es diese berühmte Regel in zwei unterschiedlichen Formulierungen gibt, einer „negativen“ und einer „positiven“; wird es doch erwähnt, wird so getan, als wäre die Aussage beider identisch.
Zwischen „Was du nicht willst, dass man dir tu’, das füg’ auch keinem anderen zu“ (negativ) und „Was ihr von anderen erwartet, das tut ebenso auch ihnen“ (positiv) liegen jedoch Welten, beide Varianten definieren unterschiedliche Ethiken. In ihrer negativen Formulierung ist die Goldene Regel das ethische Gebot zu persönlicher Freiheit. Sie beschreibt das Recht der und des Einzelnen, in Ruhe gelassen zu werden, nicht behelligt und nicht geschädigt zu werden; beziehungsweise die Verpflichtung, dieses Recht aller anderen zu achten, sie nicht zu behelligen und nicht zu schädigen. Die positive Formulierung hingegen, wie sie auch in der Bergpredigt vorkommt (Mt 7,12), gewährt genau das nicht. Sie beschreibt vielmehr die Verpflichtung, den anderen etwas zu tun. Auch wenn viele an dieser Stelle einwenden werden, dass den anderen ja Gutes, eben das, was man selbst für sich wünscht, getan werden soll, so heißt das letztlich nichts anderes, als das der/die Handelnde, also die Person, die sich durch die Regel verpflichtet fühlt, anderen das tut, was sie selbst für gut und richtig hält und nicht das, was diese anderen für gut und richtig halten. Die Goldene Regel in ihrer positiven Form kann als Aufforderung zur Zwangsbeglückung gelesen werden, die Ideologen (ob politisch oder religiös) dem Rest der Welt angedeihen lassen wollen, es ist mithin jenes Gute, von dem Thoreau sagte: „Wenn ich sicher wüsste, dass jemand in mein Haus käme, mit der festen Absicht, mir Gutes zu tun, würde ich um mein Leben laufen.“ So will der Religiöse, der das eigene Seelenheil für das Wichtigste hält, das ihm gegeben werden kann, mir womöglich Gutes tun, indem er versucht, mir ebenfalls zum Seelenheil zu verhelfen, während der Atheist möglicherweise versucht, dem Rest der Menschheit Gutes zu tun, indem er sie vom Glauben „erlöst“. Mit der positiv formulierten Goldenen Regel ist jedem Missionseifer Tür und Tor geöffnet. Wer immer zu wissen glaubt, was für alle gut ist, kann sich bei seinem Tun auf sie berufen.
Nur in ihrer negativen Formulierung begründet die Goldene Regel einen moralischen Imperativ, der Würde und Freiheit des einzelnen Menschen zum Ziel hat, denn menschliche Würde und persönliche Freiheit manifestieren sich zu allererst in dem Recht, in Ruhe gelassen zu werden.
Sieg der Salafisten?
Keine Frage, die rechtsextremen Ausländer- und Muslimhasser von Pro NRW sind ein ungustiöses Gesindel. In einem demokratischen Rechtsstaat gilt das Recht auf Meinungsäußerungsfreiheit allerdings für alle, ob uns deren Ansichten gefallen oder nicht. Eine Demokratie muss und kann das aushalten. Weiterlesen
Verbotsgesellschaft
Dirk Maxeiner und Michael Miersch haben in der Welt einen interessanten Kommentar gegen die Drogenprohibition und den War on Drugs verfasst. Eine Legalisierung wäre ihrer Meinung nach keineswegs eine Kapitulation vor dem Verbrechen, denn: „Von welchem Verbrechen reden wir? Anders als Körperverletzung Weiterlesen
Der zerstörte Traum
Nach vielen Jahren ist mir unlängst wieder ein Buch in die Hände gefallen, das hiermit wärmsten empfohlen sei: Joachim Fest, Der zerstörte Traum. Vom Ende des utopischen Zeitalters, Berlin 1991.
Zwei Jahre nach dem Zusammenbruch des sozialistischen Experiments in Osteuropa verfasste Joachim Fest diese kleine Schrift; ein Essay, in dem er einen großen Bogen spannt von den frühen literarischen Utopien eines Weiterlesen
Der Rechtsstaat verlangt die freie Rede des Angeklagten!
In seinem Leitartikel für das Profil dieser Woche schreibt Robert Treichler unter dem Titel „Die Stimme Eurabiens“, es sei zwar unerträglich, dass Anders Breivik seine Weltsicht öffentlich ausbreiten dürfe, aber man solle ihn dennoch reden lassen, weil der „Konsum von Breiviks Gesamtwerk“ „kathartische Wirkung entfalten“ könne: „Es wird Bürgern zusehends peinlich sein, denselben Nonsens zur Grundlage ihrer politischen Haltung zu machen.“ Hinter diesem Leitartikel verbirgt sich ein recht verqueres Verständnis rechtsstaatlicher Regeln.
Anders Breivik darf nicht deswegen vor Gericht frei reden, damit wir von ihm lernen, wie blödsinnig rassistische Argumente sind. Das wissen wir entweder oder werden es auch von Breivik nicht lernen.
Breivik darf frei reden, weil Norwegen ein Rechtsstaat ist und in einem solchen jeder – und das meint wirklich jeder – Angeklagte das Recht hat, sich vor Gericht zu rechtfertigen und dazu gehört auch das Ausbreiten seiner Motive, ob uns diese nun gefallen, verletzen oder empören.
Was Günter Grass gesagt hat
Zu Günter Grass fällt mir nichts ein – seine Person interessiert mich nicht, sein Alter spielt für mich keine Rolle und ebenso wenig seine längst vergangene Mitgliedschaft in der Waffen-SS. Bezüglich letzterer erscheint es mir geradezu frivol, sie im Zusammenhang mit seinem jüngsten Text zu nennen. Wer möchte gerne an seinen Handlungen als 17jähriger gemessen werden? Natürlich: Das jahrzehntelange Schweigen über die eigene Vergangenheit, während das „Gewissen der Nation“ in anderen eilfertig das Konservative oder Reaktionäre sah und brandmarkte – das wäre ein Thema für sich, hat aber mit dem jüngsten Text allenfalls am Rande zu tun. All das führt nur weg vom Thema, seinem Text, führt nur hin zu seiner Person, deren Psychologie mich eben nicht interessiert. Auch nicht, ob er Antisemit ist, sein könnte oder immer schon war. Nicht er sollte Aufsehen erregen, sondern sein jüngster Text, den nicht zu kennen kaum mehr möglich ist. Und dieser Text wäre auch dann kein anderer, wenn ein anderer ihn geschrieben hätte. Ist er anti-israelisch? Ist er antisemitisch?
Anders als ein politischer Essay, verlangt die von Günter Grass gewählte Form des Gedichts geradezu danach, den Subtext mit Bedacht zu lesen und zu entschlüsseln, denn was ein Gedicht in erster Linie vor jeder anderen Literaturgattung auszeichnet, Weiterlesen
Joachim Gauck und die Freiheit
Bundespräsident Joachim Gauck lässt mich nicht los. Nach der Lektüre seines schmalen Bändchens „Freiheit. Ein Plädoyer“ (Kösel-Verlag München 2012) ist mir die Kritik einiger Vertreter der ehemaligen kirchlichen Opposition der DDR im bereits an anderer Stelle erwähnten offenen Brief auch inhaltlich noch weniger verständlich als zuvor, denn Joachim Gauck tritt leider gerade nicht für die von ihnen kritisierte individuelle Freiheit und „individuelle Selbstermächtigung“ ein.
Auf rund 50 Seiten im Format A6 tut er seine Gedanken zu Freiheit, Verantwortung und Toleranz kund. Aus seinen Zeilen spricht allerdings mehr der Pastor als der mündige Bürger, mehr der erhobene Zeigefinger als der Ruf nach Bürgerrechten. Symptomatisch dafür ist die an zentraler Stelle platzierte Frage: „Und du, wozu bist du imstande, wofür willst du dich einsetzen? Wie willst du Freiheit gestalten?“ (S. 22) Freiheit impliziert für Joachim Gauck die Verpflichtung zu gutem Handeln: „Ich nenne die Freiheit der Erwachsenen ‚Verantwortung‘.“ (S. 26, sowie der Schlusssatz auf S. 62) Offensichtlich glaubt er, aus seiner persönlichen Vorstellung davon, was er mit seiner individuellen Freiheit anzufangen gedenkt – gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen –eine ähnliche Verpflichtung für alle ableiten zu können. Damit aber bedeutet sein Begriff von „Freiheit“ dann nicht mehr individuelle Freiheit. Vielmehr ist die oder der Einzelne in dieser Sicht, ganz der protestantischen Ethik folgend, auf einen gesellschaftlich nützlichen Platz berufen. Untermauert wird diese Vorstellung mit fast schon demagogischen Beispielen, die einer Predigt entnommen sein könnten, und ein dem Menschen quasi angeborenes Bedürfnis unterstellen, sich für andere einsetzen zu dürfen. Darin, dass die/der Einzelne sich für geliebte Menschen (Partner, Partnerin, Kinder) verantwortlich fühle und bereit sei, sich für diese zu opfern, zeige sich ein menschliches Grundbedürfnis zur Verantwortung für andere, für die Gesellschaft, für die Menschheit: „Wir begreifen: Wir sind geboren zur Lebensform der Bezogenheit.“ (S. 29) Die Fähigkeit des Menschen, Verantwortung für andere zu übernehmen, wird bei Gauck zur angeborenen Verpflichtung: „Unsere Fähigkeit zur Verantwortung ist somit nicht etwas, das durch Philosophen, Politiker oder Geistliche quasi von außen in unser Leben hineingebracht würde, sie gehört vielmehr zum Grundbestand des Humanum. Wir verlieren uns selbst, wenn wir diesem Prinzip nicht zu folgen vermögen.“ (S. 36)
Es ist nichts dagegen einzuwenden, andere zu mehr Verantwortung und Engagement anspornen zu wollen. Aber darüber hinaus in beiden eine Verpflichtung zu sehen, durch die sich erst die Freiheit des Menschen offenbare, erinnert fatal an den Aktivbürger der antiken griechischen Polis; es erinnert an die Pflicht zur Beteiligung in kollektivistischen Systemen und ist schlicht eine Anmaßung. Damit erhebt Gauck seine persönliche Meinung zum gesellschaftlichen Imperativ. Individuelle Freiheit ist jedenfalls etwas anderes. Aus gutem Grund kennen moderne demokratische Staaten keine Wahlpflicht mehr, sondern nur ein Wahlrecht. Die Freiheit des mündigen Bürgers zeigt sich, anders als der Bundespräsident zu glauben scheint, gerade darin, nicht mittun zu müssen, sich nicht beteiligen zu müssen, sondern ein Recht darauf zu haben, in Ruhe gelassen zu werden. Die Forderung, nur gut handeln zu dürfen, also Freiheit nur in einer Richtung nutzen zu dürfen, stellt – ganz abgesehen von dem philosophischen Problem, was denn nun gut und richtig ist – die Freiheit prinzipiell in Frage. Freiheit verdient diesen Namen nur, wenn sie die/den Einzelnen nicht nur dazu ermächtigt, richtig zu handeln, sondern auch dazu, falsch zu handeln, nicht nur gut, sondern auch schlecht. Verantwortung besteht dann allein darin, bereit zu sein, die Folgen des eigenen Handelns zu tragen. In Freiheit handeln heißt, selbst-verantwortlich zu handeln.
PS: Der Vollständigkeit meiner Kritik halber sei aber auch erwähnt, dass seine Ausführungen zu Toleranz, Menschenrechten und Europa im letzten Viertel des Bändchens auf dem knappen Raum äußerst prägnant und präzise den Kern der Probleme treffend, dargestellt sind.
Freiheit und Gleichheit
„Freiheit ist Freiheit, nicht Gleichheit oder Fairness oder Gerechtigkeit oder Kultur oder menschliches Glück oder ruhiges Gewissen.“ (Isaiah Berlin)
Gleichheit und individuelle Freiheit stellen einander entgegengesetzte Pole dar, vor allem, wenn unter Gleichheit soziale Gleichheit oder ganz allgemein die Gleichheit aller Menschen verstanden wird. Hinter dem Wunsch oder der Forderung nach Gleichheit verbirgt sich meist eine Ideologie mit der einhergehenden Vorstellung vom „richtigen Leben“, die, wenn sich nur alle daran hielten, auch für alle den Weg zum Glück weisen würde. Da die Menschen aber von Natur aus verschieden und mit unterschiedlichen Fähigkeiten ausgestattet sind, und individuelle Wünsche und Vorstellungen entwickeln, lässt sich Gleichheit nur durch Zwang herstellen. Vom jakobinischen Terror im Anschluss an die französische Revolution bis zum sozialistischen Experiment in Osteuropa bedeutete die Forderung nach Gleichheit zu allererst Terror gegenüber jenen, die sich der Gleichschaltung nicht unterwarfen oder auch nur den Anschein erweckten, ein eigenes und selbstbestimmtes Leben führen zu wollen. Gleichheit durchsetzen zu wollen, heißt, das Individuum zugunsten eines kollektivistischen Paradieses zu knebeln und seine individuelle Freiheit zu leugnen. Zur Gleichheit der Menschen hat all das dennoch nicht beigetragen, einige waren auch im Sozialismus gleicher als die Masse. Benjamin Constant schrieb, als er die Konsequenzen aus den Folgen der französischen Revolution zog: „Wir wollen die Regierung bitten, innerhalb ihrer Grenzen zu bleiben. Sie möge sich darauf beschränken, gerecht zu sein. Für unser Glück werden wir selber sorgen.“ Noch prägnanter drückte sich der amerikanische Philosoph Henry David Thoreau aus: „Wenn ich sicher wüsste, dass jemand in mein Haus käme, mit der festen Absicht, mir Gutes zu tun, würde ich um mein Leben laufen.“
Während einerseits der Versuch, totale Gleichheit der Menschen herzustellen, in Terror endet, so führt andererseits ungezügelte Freiheit zu sozialer Ungerechtigkeit und Unterdrückung. In Gesellschaften ohne jegliche Beschränkung der Freiheit des Einzelnen wird es einigen wenigen gelingen, mittels wirtschaftlicher und politischer Macht ihre Freiheit zu Lasten anderer auszuweiten, andere zu unterdrücken und wirtschaftlich auszubeuten. Absolute Freiheit mündet in der Unfreiheit der Masse. Daher sind Gesellschaft und Staat gefordert, zwischen den beiden Polen Freiheit und Gleichheit einen Ausgleich zu finden: Es muss einerseits so viel individuelle Freiheit gewährt werden wie möglich, ohne dass die Freiheit anderer dadurch eingeschränkt wird, andererseits muss soziale Ungleichheit so weit eingedämmt werden, dass allen Menschen ein Leben in Freiheit möglich ist.
Je mehr Freiheit, umso weniger Gleichheit und vice versa – gleichwohl führt eine Gesellschaft, die die individuelle Freiheit all ihrer Mitglieder achtet, zur einzigen Art von Gleichheit, die in menschlichen Gesellschaften verschiedener und ungleicher Individuen überhaupt möglich scheint: Der Gleichheit in ihrer individuellen Freiheit, die in der Gleichheit vor dem Gesetz ihren tiefsten Ausdruck findet.
Freiheit und Verantwortung
Als Plädoyer für Freiheit und Verantwortung wird die Antrittsrede von Bundespräsident Joachim Gauck in den Medien bezeichnet. Der Hinweis, dass Freiheit mit Verantwortung verbunden sei, wird oft ins Zentrum gerückt. Dabei klingt mancherorts implizit die Vorstellung an, diese Verantwortung sei eine Verantwortung für die Gesellschaft und Freiheit somit an einen Dienst an der Gesellschaft gekoppelt (hier, hier und hier).
In dieser Sicht stehen Freiheit und Verantwortungen in einer indirekten Reziprozität zueinander: Freiheit wird dem Einzelnen gewährt und im Gegenzug muss er Verantwortung übernehmen. Das erinnert an die Vorstellung des aktiven Bürgers der griechischen Polis, es erinnert an die Idee einer demokratischen Gesellschaft, in der der Einzelne nicht frei, sondern gezwungen ist, mitzugestalten. Mit individueller Freiheit und einer modernen Demokratie ist diese Auffassung nicht vereinbar.
Keine Frage: Freiheit ist an Verantwortung gebunden – aber wenn mit individueller Freiheit die Freiheit jeder und jedes Einzelnen gemeint ist, dann besteht die Verantwortung darin, allen anderen die gleiche Freiheit zu gewähren. Genau darin findet jede Freiheit auch ihre Schranke. Diese Schranke ist zugleich ein moralisches Gebot und die Grundlage der Freiheit an sich, denn grenzenlose Freiheit aller ist nicht möglich und grenzenlose Freiheit weniger hieße Despotie und Unterdrückung aller anderen. Verantwortung besteht im Zusammenhang mit Freiheit also schlicht in der reziproken Anerkennung der gleichen Freiheit aller anderen – und nicht in der Verpflichtung zur Gestaltung.